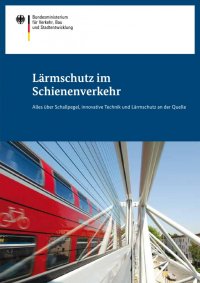
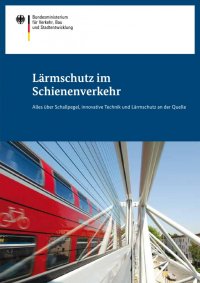
4. Die Lärmvorsorge Eine Verpflichtung zur Lärmvorsorge besteht ab 1.4.1974 (alte Bundesländer) bzw. 1.7.1990 (neue Bundesländer) für den Neubau oder wesentliche Ände- rungen von Schienenwegen (§§ 41, 67 a BImSchG). Andere Änderungen, wie z.B. die Erhöhung der Zugzahlen, lösen keinen Anspruch auf Lärmschutz aus. Die Rechtsgrundlage für die Lärmvorsorge sind die §§ 41 - 43 des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit der Verkehrslärm- schutzverordnung (16. BImSchV) und die Verkehrswege-Schallschutzmaß- nahmenverordnung (24. BImSchV). Beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Eisen-, Straßen- und Mag- netschwebebahnen sind schädliche Verkehrsgeräusche soweit wie möglich zu vermeiden. Dies geschieht vorrangig durch Schutzmaßnahmen am Verkehrsweg, z.B. durch Lärmschutzwände und -wälle. Ist dies nicht möglich oder stehen „die Kosten der Schutzmaßnahmen außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck“ (siehe § 41 Abs. 2 BImSchG), müssen geeignete Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Schallschutzfenster) an den betroffenen Gebäuden durchgeführt werden. Art und Umfang der zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche notwendigen Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen legt die Verkehrswege- Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) fest. Diese passiven Lärmschutzmaßnahmen sind vom Eigentümer vorzunehmen. Die ent- standenen und durch Rechnung belegten Kosten werden in notwendiger Höhe erstattet. Die Lärmvorsorge schützt neben den Innenräumen des Gebäudes auch sogenannte Außenwohnbereiche, die dem „Wohnen im Freien“ dienen. Das sind z.B. Balkone und Terrassen. 4. Die Lärmvorsorge 23