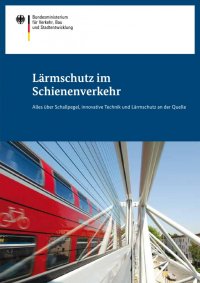
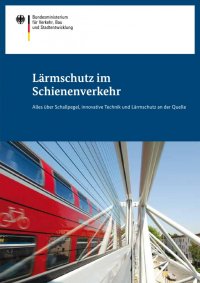
Das menschliche Ohr reagiert auf niedrige Frequenzen – also auf tiefe Töne – weniger empfindlich als auf hohe. Die sogenannte A-Bewertung berück- sichtigt diese Besonderheit. Beurteilungspegel für Verkehrsgeräusche werden deshalb grundsätzlich in A-bewerteten Schallpegeln angegeben. Ihre Einheit ist das Dezibel (A) bzw. das dB(A). 1.1. Der Schallpegel Für jedes Schallereignis gibt es einen Schallpegel. Der Pegelverlauf stellt die Entwicklung des Schallpegels dar. Innerhalb dieses Pegelverlaufes unter- scheidet man den Grundgeräuschpegel und den Spitzenpegel. Der Grund- geräuschpegel gibt den Umgebungslärm an, ohne dass die zu beurteilende Geräuschquelle, zum Beispiel der Schienenverkehrslärm, dazu beiträgt. Der Spitzenpegel ist der maximale Wert eines Schallereignisses. Er wird auch Maximalpegel oder Vorbeifahrtpegel genannt. 1.2. Der Mittelungspegel Der Mittelungspegel dient der Kennzeichnung zeitlich veränderlicher Schallpegel durch nur eine Zahl. Er wird in Dezibel (A) oder dB(A) angege- ben. In den Mittelungspegel gehen Stärke und Dauer jedes Einzelgeräusches während eines bestimmten Beurteilungszeitraumes (z.B. 1 Stunde) ein. Für den Schienenverkehr wird der Mittelungspegel am Wohnort von Anwoh- nern bestimmt. Alle Zugfahrten in einem bestimmten Zeitraum (Tag: 6 bis 22 Uhr, Nacht: 22 bis 6 Uhr) werden zu einem logarithmischen Mittelungs- pegel zusammengefasst. In diesen gehen Stärke und Dauer jedes Einzelge- räuschs ein. Pegelspitzen werden durch ihre hohe Intensität entsprechend stark berücksichtigt. Beispiel: Fahren innerhalb einer Stunde 15 Regionalzüge mit Spitzenpegeln von 81 dB(A), so entsteht ein Mittelungspegel von rund 67 dB(A), obwohl zu etwa 95 Prozent dieser Zeit keine Zugbewegungen stattfinden. Dieses Beispiel 1. Die Grundlagen: Schall und Lärm 7